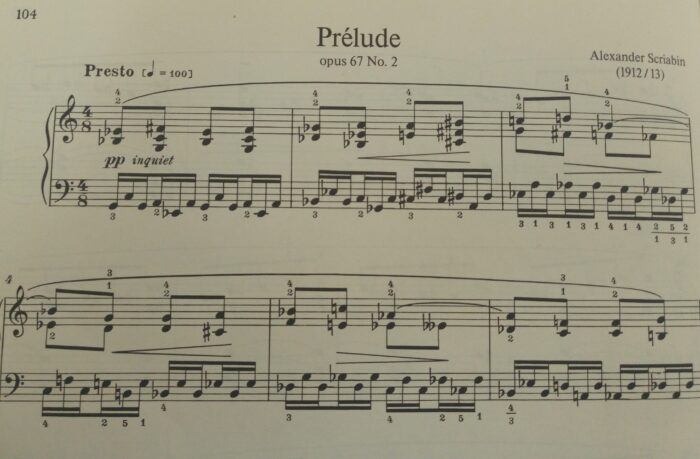Es gibt Reiseliteratur und umgekehrt ebenfalls literarisches Reisen. Andreas Maier, mir aus den Medien aufgrund seiner schriftstellerischen Beschäftigung mit seiner Heimat, der Wetterau, bekannt, schildert in seinem neuen Roman Die Städte bereiste Destinationen zu unterschiedlichen Zwecken und Lebensphasen (von der Kindheit bis zu seinen Studienzeiten). Auch hier setzt Maier mit seiner Heimat ein, indem er über seinen Erzähler Andreas – autobiographische Bezüge sind unverkennbar –bedeutende Veränderungen kurz beschreibt. Die einzelnen Kapitel lauten „Nürnberg, Brenner, Brixen“, „Athen“, „Biarritz“, „Oulx“, „Bangkok, Friedberg, Marrakesch“, „Weimar“. Augenscheinlich geht es jeweils nicht nur um Städte bzw. Orte, auch wenn der erste Satz des Romans in den einleitenden Worten lautet: „Die Städte kamen sich näher.“ Dieser Auftakt ist ein Schlüssel zum Verständnis von Maiers Prosa, da es ohne die Wetterau als Bezugspunkt, die sich zwischen Bad Nauheim, Friedberg und den nördlichsten Stadtteilen Frankfurts erstreckt, dieses Buch nicht gäbe. Das Zusammenwachsen dank der Ortsumgehung (neben der Autobahn A5 und der S-Bahn-Anbindung) ist so sinnbildlich, dass Maier einem mehrbändigen Romanzyklus den Titel Ortsumgehung gegeben hat.
Womöglich wäre es sehr spannend, im Maier’schen Romankosmos die vielen Bezugspunkte zwischen heimischen und fernen Gefilden abzustecken. Diese Relationen helfen, Lebensbewegungen zu verstehen. Beziehungen zu im geografischen Raum verteilten Menschen bilden in Die Städte den Ausgangspunkt von Reisebeschreibungen; diese geben Anlass für so manche, tendenziell freudlose Entdeckung. Die Schilderungen sind oft nüchtern und nicht selten lakonisch. Das „Unterwegssein“, wie es auf dem Buchrücken des Suhrkamp-Bands heißt, wird zum Leitmotiv.
Zahlreiche Rezensionen beschäftigen sich mit dem Roman und seinem Kontext. Beim rbb ist abstrakt von einem „biografisches Bewegungsprofil“ die Rede, im Deutschlandfunk Kultur, wo Maier interviewt wurde, von „Wahrnehmungs- und Zustandserkundungen“ auf „verschiedenen Entwicklungsstufen des Erzählers“. Das ist die inhaltliche Seite, doch wird hier wie im WDR-Bericht auch über die Sprache gesprochen. „Sprachfindung“ als „Lebensrettung“ ist die Formulierung hier (Deutschlandfunk Kultur), „Geburt des Ich-Erzählers aus dem Geist der Sprache“ dort (WDR). Wenn hier auch noch ein gewisser Zauber in einem transkulturellen Kontext zum Tragen kommt, dann verschwindet die Bewegung an einen fremden Ort hinter der Bewegung der Dinge. Sprache bringt Welt im wahrsten Sinne des Wortes zum Vorschein und entfaltet sie, indem sie mehrere Dinge aufrufen und in einen geradezu faszinierenden Kontext stellen kann. Folgendes Zitat könnte gut in einen kommunikations-wissenschaftlichen Reader aufgenommen werden:
Ich bestellte einen Ouzo (unwahrscheinlich, dass ich je vorher Ouzo getrunken hatte, aber ich wusste, man trank das als Grieche). Der Mann stellte mir mit Bewegungen, die ich ungewöhnlich elegant fand und die ich höchstens mit den Bewegungen gewisser italienischer Kellner vergleichen konnte, ein Glas vor mich, goß Ouzo hinein, dann nahm er eine Karaffe, füllte sie unter einen Wasserhahn, gab Eiswürfel hinzu, steckte in die Karaffe einen Löffel und kredenzte das ebenfalls. Es sah aus wie eine Zeremonie: Ich hatte das Wort Ouzo genannt, und plötzlich, in einem bestimmten Ritual, kamen all diese Gegenstände in eingeübter Reihenfolge auf den Tisch. Ich war beeindruckt, dass ich der Urheber eines solchen Brimboriums sein konnte. Nun aber holte der Barkeeper hinter seinem Tresen auch noch ein Schälchen mit Oliven hervor, stellte es auf eine Papierserviette, die er vor mir postierte, und daneben noch ein Gefäß mit Zahnstochern und ein weiteres Schälchen, offenbar für die Kerne und die benutzten Stocher. Meine Ein-Wort-Bestellung hatte also wie von Zauberhand vor mir erscheinen lassen: Glas, Ouzo, Karaffe, Wasser, Eis, Löffel, Serviette, Schälchen, Oliven, Gefäß mit Zahnstochern, zweites Schälchen. Zwölf Dinge auf ein Wort hin.
Zwei Silben sorgen dafür, dass eine kleine Genuss-Welt en miniature entsteht. Das Staunen über diese kleine Szene lässt sich genauso herauslesen wie das Stauen des Erzählers über die eigene Macht, eigens Auslöser dieses „Rituals“ gewesen zu sein.
Ich bin mir sicher, dass das Roman-Universum von Andreas Maier in wenigen Jahren,wenn der Romanzyklus Die Ortsumgehung abgeschlossen sein wird, mindestens eine mehrtägige Konferenz verdient hätte. Eine Poetik der Ortsumgehung untrennbar literarisch-geografisch zu skizzieren lädt zur Spurensuche in Wort und Schrift ein, wozu Reiseziele die Staffage darstellen, an denen man auch getrost vorbei fahren kann.
Im Suhrkamp-Verlag ist das Buch verlegt worden.