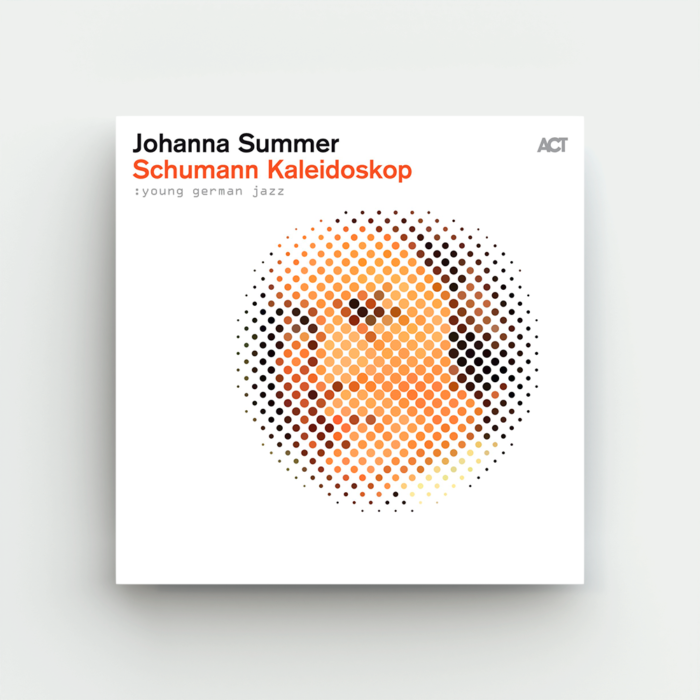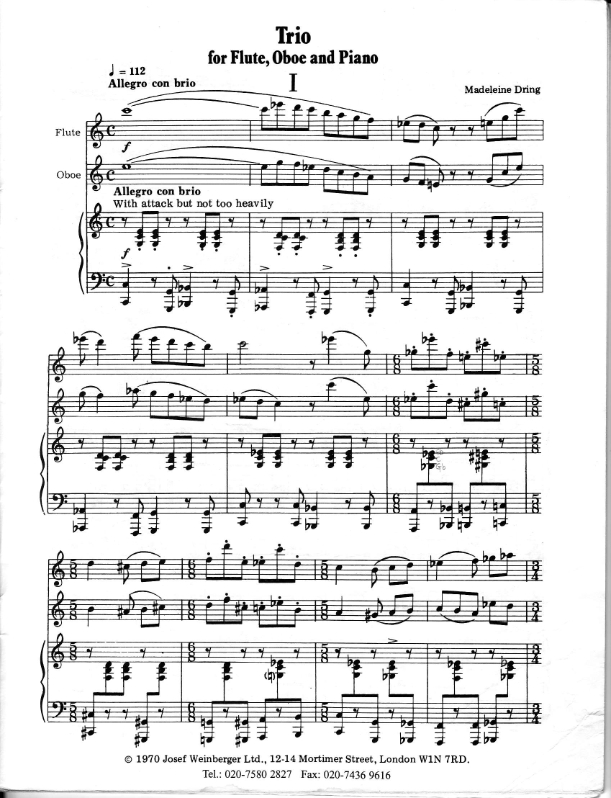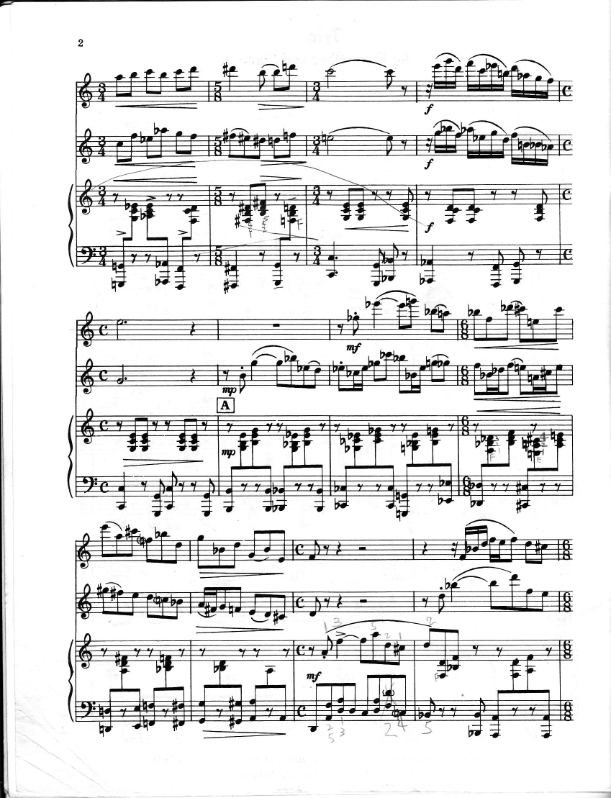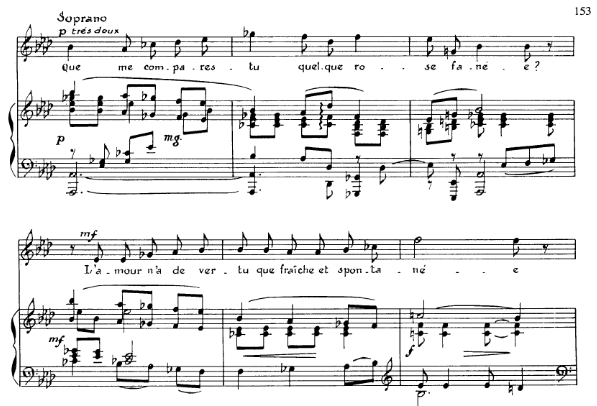Das Sächsische Mozartfest bietet keinesfalls nur einen Fokus auf die Wiener Klassik, also auf das späte 18. Jahrhundert. Es wagt auch einen Blick über den ästhetischen Tellerrand hinaus. Ich staunte nicht schlecht, als ich erfuhr, dass der Jazzkomponist Stephan König nicht nur auf diesem Fest musizieren, sondern auch den Mozartpreis 2024 von der Sächsischen Mozart-Gesellschaft) bekommen würde.
Stephan König ist wohl nur eingeweihten Jazzenthusiasten ein Begriff. Als ich 2021 in einem großen Leipziger Notenladen unweit des Gewandhauses den Band 12 Préludes. Jazzinspirierte Klangbilder entdeckte, war mir bewusst, dass sie für mich, der ich in meinen Jugendjahren kaum mit dem Jazz in Berührung kam, eine große Herausforderung bieten würden. Ohne meinen Lehrer Thomas Unger am Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium eine allzu schwere Hürde. Die Stücke sind durch eine ungeheure Klangvielfalt gekennzeichnet; zumindest klingen einzelne Takte immer wieder anders, je nach eigener Stimmung. Sie zeigen Königs Anspruch, Komposition und Improvisation miteinander zu verbinden, ebenso wie verschiedene Genres der Klaviermusik. Um puristischen Jazz handelt es sich also nicht.
Ein Klaviergespräch wie Anfang Mai verbindet Musik und eine gewisse Neugier auf Hintergrundinformationen über eine Komposition bzw. einen Komponisten. Die Halle der Villa Esche, am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums, 1903 für den Textilunternehmer Rudolf Esche fertiggestellt und nach mehrjähriger Renovierung um die Jahrtausendwende als Veranstaltungs- und Tagungsort konzipiert, eignet sich hervorragend für ein solches Gespräch, das eine Ausprägung von Salonkultur ist. Gut möglich, dass der Architekt Henry van de Velde auch schon an diese Möglichkeit gedacht hatte. Weniger intim als in einem beengten Wohnzimmerkonzert können die Klänge sich leicht in die oberen Etagen verflüchtigen. Für Gesang und Instrumentalmusik ergeben sich hier sicher besondere akustische Phänomene.
Die MDR-Radiomoderatorin Julia Hemmerling leitete souverän und unterhaltsam das Gespräch. Die Fragen führten angenehm in ein Universum hinein, das eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Die Stimmung ist, wie wir wissen, vom Gebäude abhängig, und damit auch die Harmoniefolge: Die Villa-Esche sei für den A-Dur-Dreiklang prädestiniert, wenn man König Glauben schenkt. Faszinierend. Der Laie kann hier keine Erklärung verlangen, genauso wenig wie bei Farbstimmungen. Es gelten hier nicht die Gesetze der Logik, sondern allein die Gefühle, die von Ort zu Ort unterschiedlich sind.
Man kann jedoch das Ephemere der Musik begreifen, denn genauso schnell wie sie entsteht, verschwindet sie auch. Im Moment des Klangs gebe es laut König eine Spannung, die auch den „Aspekt des Loslassens“ impliziert, also eine Entspannung.
Im zweiten Gesprächsteil erzählte Stephan König von seinem Studium an der Leipziger Hochschule für Musik, wo er laut Homepage als „Diplom-Dirigent, Diplom-Pianist und Diplom-Komponist“ abschloss, und von seinem Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee kurz vor und während der Wendezeit. Widerstände gegen seine Art des Musizierens spürte er während des Studiums, gerade weil er an der Hochschule öfters statt der vorgesehenen Stücke improvisierte. Gerettet habe ihn in der Kaserne der Zugang zu einem Klavier in einem Dachzimmer, wohin er sich nachts geschlichen habe.
In seinen Improvisationen baute er an dem Abend jeweils einen der drei Sätze des 23. Klavierkonzerts (in A-Dur) von W.A. Mozart ein. Ein kühnes Unterfangen, das mich an das Schumannfest 2023 erinnerte, auf dem Johanna Summer während ihres Solo-Konzerts Kompositionen von Robert Schumann in ihr Werk einflochte.
Im Programmheft ist die Rede davon, dass Stephan Königs Klangwelten einen „Perspektivwechsel des Hörens, somit des Denkens und Empfindens“ ermöglicht. Im Moment des Live-Erlebnisses wird diese eher plakative Formulierung plastisch. Sicherlich werde ich im Laufe des Jahres einen weiteren Ort mit neuen König-Momenten aufsuchen. Und dann werde ich auch wieder anders hören, denken und empfinden. Und womöglich etwas besser improvisieren können….
Drei Préludes von Stephan König können auf seiner Homepage angehört werden. Die Einspielung kann im Online-Musikalienhandel erworben werden, die dazugehörigen Noten über stretta-music.