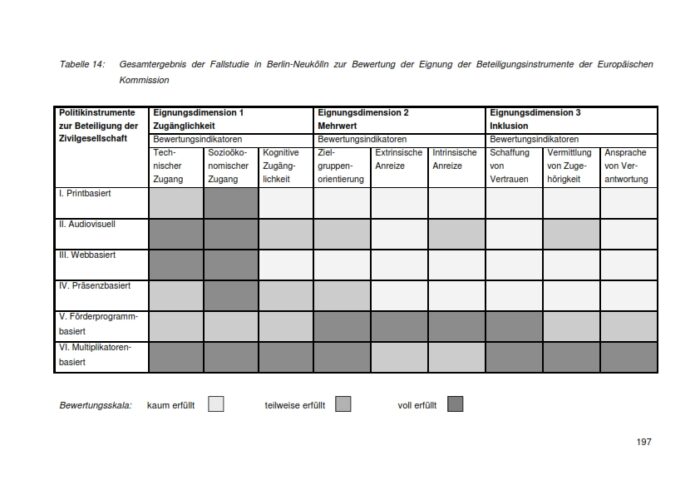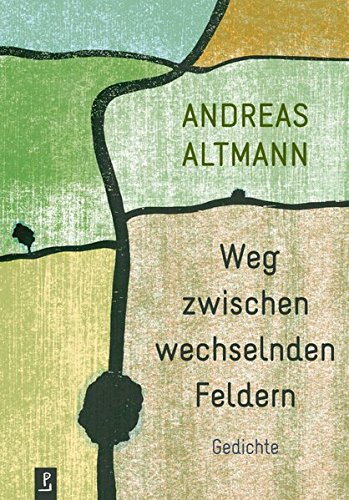Spätestens seitdem es die Pendlerpauschale (offiziell: Entfernungspauschale) gibt, ist das Pendeln eine politisch subventionierte Tugend geworden. Die Pauschale, deren Abschaffung mal mehr, mal weniger diskutiert wurde , gilt ab dem ersten Kilometer, der zwischen Arbeits- und Wohnort liegt. Nach der Pandemie wird das Home-Office zwar nicht ausgedient haben, doch werden sich wieder mehr (Büro-)Menschen auf ihren Arbeitsweg machen. Was anders als „Büromenschen“ zwangsläufig Fabrikarbeiter, Krankenschwestern und Reinigungskräfte bis zu mehreren Stunden pro Tag machen müssen, kann man als enormen Kraftakt bezeichnen: Gut 19 Millionen Bundesdeutsche können sich, wenn sie Gemeindegrenzen überschreiten, als Pendler definieren, wie Der Spiegel Anfang 2020 berichtete; neulich meldete heute.de, dass deutlich mehr als 3 Millionen Bundesdeutsche über (Bundes-)Ländergrenzen pendelten, Tendenz steigend. Durchschnittlich werden dabei knapp 20 km pro Strecke zurückgelegt. Die meisten würden gerne auf solche Wege verzichten, doch 2018 hörte ich einen Manager eines mittelständigen Unternehmens bei seiner Selbstvorstellung auf einer Forumsveranstaltung sagen, dass er den längeren Arbeitsweg im Auto bräuchte, um sein Tagwerk zu reflektieren. Wenn man wie er aus der Stadt (Großraum Bonn) kommt und im Siegtal arbeitet, lassen sich Distanzen recht stressfrei überbrücken.
Pendeln ist ein im Alltagsdeutsch fest etablierter Begriff, den man im Englischen mit „to commute“ und im Französischen mit „se déplacer“ im Hinblick auf den (gemeinsamen) Ortswechsel übersetzen kann. Das Metaphorische des stetigen Hin und Her geht hierbei verloren. Es geht im Grunde um etwas sehr Rhythmisches: Man mag an ein Pendel denken, das in früheren Zeiten über das gleichmäßige Hin- und Herschwingen ein Uhrwerk in Gang setzte.
Neulich kam mir das Pendel als Metapher wieder deutlich in den Sinn, als ich die letzten Seiten von Deborah Feldmans Roman Überbitten las. Der spannende autobiografische Roman, der im Grunde einen Brückenschlag zwischen Feldmans alter Heimat New York und ihrer neuen Heimat Berlin und ihre Loslösung vom orthodoxen Judentum hin zu einem weltlicher geprägten Lebensstil beschreibt, ist dafür genau die richtige Grundlage. Das Pendel hat bei Feldman selbstverständlich nichts mit dem Pendeln im Arbeitskontext zu tun, sondern beschreibt einen kulturellen Annäherungs- bzw. „Aneignungsprozess“ . In der btb-Ausgabe heißt es (S. 688):
Will man den Prozess der kulturellen Aneignung verstehen, vor allem, wie er in meinem persönlichen Fall greift, dann muss man an die alte Metapher des Pendels denken. Der Raum, der zwischen zwei Kulturen besteht, ist keine klar gezogene Linie, sondern ein unbegehbarer Abgrund. Beim Prozess des Schwingens über ihm, ganz so, wie man sich vielleicht eine Art Pionier-Tarzan vorstellen mag, kommt man nicht auf der angestrebten Seite mit einem einzigen Abstoß an, sondern eher, indem man vor- und zurückschwingt, vor und zurück, mit einem stetig wachsenden Schwungmoment. Jedes Mal, wenn man weiter wegschwingt als zuvor, das heißt, die andere Seite zurückweist, ist man naturgemäß mit dem folgenden Moment näher an sie herangetrieben. Damit will ich nur sagen, dass meine instinktive und animalische Zurückweisung des Landes, das ich zugleich als mein wahres Zuhause bezeichnen möchte, ein wesentlicher Teil des Aneignungsprozesses war und bleibt. Wie meine Großmutter es mir gesagt hatte, ist die Welt in Gegensätzen erschaffen, ohne Dunkelheit würde es kein Licht geben, ohne die Kraft meiner Abstoßung gäbe es meinen Antrieb nicht.
Die für mich einleuchtende Einstellung könnte man in gewissem Maße auch für jeden geografischen Pendelvorgang ausweiten, da ja auch zwischen Unternehmenskultur und Privatleben oft scheinbar unüberbrückbare Differenzen bestehen. Nur wenn man den zu Anfang fremden Betrieb als ein Teil des Zuhause ansieht, kann man sich etwas davon aneignen, gerade wenn eine längere Betriebszugehörigkeit besteht. Man gehört also dazu, ist nicht einfach nur vor Ort. Nicht wenige verbringen werktags mehr Zeit im Betrieb als daheim und müssen den Schwung mitunter auch mit der Abstoßung verbinden. Hier allerdings lauert die Doppeldeutigkeit von „Abstoßung“, die zu Missverständnissen führen kann. Das energiereiche Abstoßen kann jedenfalls sehr schnell eine spürbare Anziehungskraft von der Gegenseite erzeugen. Das Pendel kann, wie ich finde, in Feldmans Modell auch mit einem Magnet als Kraftfeld verknüpft werden, der die Anziehung nur noch verstärken würde, wenn im Zeitverlauf eine Art Umpolung stattfindet.
Auch im Arbeitsalltag ist das Unvertraute eher anziehend, gerade wenn bestimmte Herausforderungen erwartet werden. Die physikalische Kategorie „Schwungmoment“ ist in vielen Belangen entscheidend, auch wenn die meisten Leser Physiker befragen müssten, wie sie eigentlich genau definiert ist. Jedenfalls gilt: Wer eine gewisse Schwungkraft in Annäherungsprozessen zwischen Kulturen verspürt, hat es leichter. Mit diesem Gespür pendeln und schwingen sich nämlich im günstigen Fall von allein die Dinge ein.
Hörenswert ist ein Feature vom SWR zum Pendeln (2018).
Der lesenswerte Roman von Deborah Feldman ist in deutscher Übersetzung im btb-Verlag erschienen.